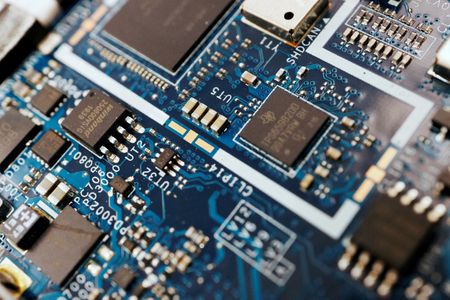Berlin/Düsseldorf (Reuters) – Die neue Kraftwerksstrategie der Bundesregierung mit konkreten Plänen zur Ausschreibung neuer Gaskraftwerke stößt auf ein geteiltes Echo.
Energiekonzerne wie Uniper begrüßten die Pläne am Freitag, während von Umweltverbänden und Teilen der Wirtschaft Kritik kam.
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte sich am Donnerstagabend darauf verständigt, zur Sicherung der Stromversorgung im Jahr 2026 steuerbare Kraftwerkskapazitäten im Umfang von zehn Gigawatt auszuschreiben, die bis 2031 in Betrieb gehen sollen. Allerdings muss zunächst die EU-Kommission dafür noch grünes Licht geben. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) steht dazu seit Monaten in Verhandlungen mit Brüssel.
Die neuen Kraftwerke sollen dann einspringen, wenn Sonne und Wind nicht ausreichend Strom liefern. Von den zehn Gigawatt sind acht Gigawatt für neue Gaskraftwerke vorgesehen, die für einen Mindestbetrieb von zehn Stunden ausgelegt sein müssen. Die übrigen zwei Gigawatt sollen technologieoffen vergeben werden, sodass auch Batteriespeicher zum Zuge kommen könnten.
Alle neuen Gaskraftwerke müssen von Beginn an für eine Umrüstung auf Wasserstoff ausgelegt sein. Ihre Dekarbonisierung bis spätestens 2045 soll “technologieoffen” erfolgen, was neben Wasserstoff auch die Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) offenlässt. Zusätzlich sollen in den Jahren 2026 und 2027 mindestens zwei Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden, die frühzeitig und verpflichtend auf Wasserstoff umstellen müssen und dafür eine Betriebskostenförderung erhalten.
KOALITION SPRICHT VON BRÜCKE ZU KAPAZITÄTSMARKT
Die Koalition sieht darin eine Brücke zu einem umfassenden, technologieoffenen Kapazitätsmarkt, der ab 2032 die Versorgungssicherheit kosteneffizient gewährleisten soll. “Die notwendigen Regelungen werden wir bis spätestens 2027 verabschieden und die Ausschreibungen dazu starten”, heißt es im Koalitionsbeschluss. Bei einem Kapazitätsmarkt wird das Vorhalten von Kraftwerksleistung vergütet. Betreiber erhalten also Geld dafür, dass sie ihre Anlagen bei Bedarf zur Verfügung stellen, um die Stromversorgung zu sichern.
Mit dem Beschluss bleibt die Koalition zunächst hinter den Plänen aus dem Koalitionsvertrag zurück, der einen Zubau von bis zu 20 Gigawatt vorsieht. Reiche sprach dennoch von einem starken Signal. “Die kurzfristige Ausschreibung von insgesamt zwölf Gigawatt steuerbarer Kapazitäten sind Grundlage für eine gesicherte Stromversorgung Deutschlands und damit für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie”, erklärte Reiche. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte am Donnerstagabend, die EU-Kommission habe signalisiert, dass die Pläne genehmigungsfähig seien. Die Finanzierung ist aber offen.
Aus der Wirtschaft kam überwiegend positive Resonanz. Der Energiekonzern Uniper begrüßte die Einigung als den “energiepolitischen Startschuss, auf den Deutschland gewartet hat”. Auch der Energieversorger RWE nannte die Einigung einen notwendigen Schritt. Man warte nun auf die Details der Ausschreibungen, die frühzeitig im kommenden Jahr stattfinden müssten. “Dann könnten erste Anlagen bereits 2030 den Betrieb aufnehmen”, sagte ein RWE-Sprecher. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Gewerkschaft IG BCE bewerteten die Einigung ebenfalls positiv. Verbände wie der BDEW und VKU nannten den Beschluss ein wichtiges Signal, bemängelten jedoch, dass die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) keine Rolle spiele und forderten faire Ausschreibungsbedingungen für Stadtwerke.
Die DIHK lehnte die Strategie hingegen ab. Statt staatlicher Förderung sei es effizienter, Stromversorger zu verpflichten, Lieferungen am Markt abzusichern. Scharfe Kritik kam von Umweltverbänden. Die Deutsche Umwelthilfe wertete die Einigung als “schwere Schlappe für Wirtschaftsministerin Reiche” und kritisierte die “planwirtschaftliche Fixierung” auf Gaskraftwerke. Der Bundesverband Erneuerbare Energie äußerte sich skeptisch, ob der Zubau rechtzeitig umgesetzt werden könne.
(Bericht von Holger Hansen und Matthias Inverardi, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)